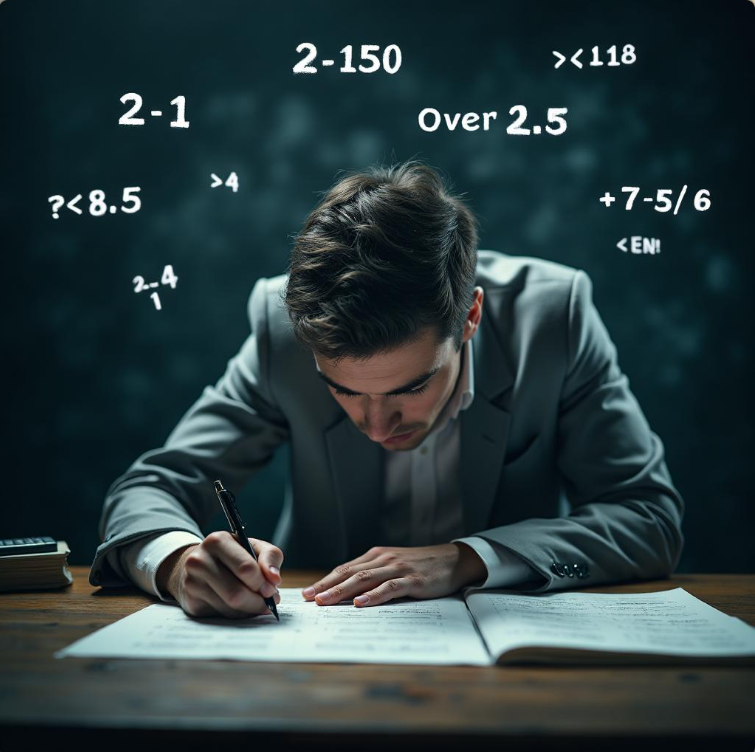Value Betting – Wie man langfristig gewinnen kann
Value-Betting – die einzige realistische Gewinnmöglichkeit
Die einzige realistische Möglichkeit, mit der man langfristig beim Wetten gewinnen kann, besteht darin: Die Eintrittswahrscheinlichkeit des gewetteten Ereignisses muss in einem günstigen Verhältnis zur Quote stehen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Quote, die man auf den Tipp bzw. die Wette bekommt, höher ist als der Kehrwert der Wahrscheinlichkeit.
Im Grunde ist das noch relativ einfache Mathematik. Man könnte es an simplen Beispielen des Münzwurfs, eines Würfels oder auch des Roulettespiels erklären. Der Unterschied, der hier allerdings im Vergleich zu Sportwetten besteht, ist der: Bei den genannten Beispielen würde man im Prinzip auf bekannte Wahrscheinlichkeiten wetten.
Beim Münzwurf ist es 50%, bei einem Würfel ist jede Zahl mit 16,67% (1/6) gleich wahrscheinlich, beim Roulette gibt es 37 Zahlen, die alle gleich wahrscheinlich drankommen – auch hier kann man die Wahrscheinlichkeiten auf alle Chancen, die man „wetten“ (seine Chips platzieren) kann, exakt berechnen.
Beim Sport hingegen kennt man die Wahrscheinlichkeiten nicht genau. Aber genau das macht das Value-Betting überhaupt erst möglich. Dadurch, dass die Wahrscheinlichkeiten unbekannt sind, kann es zu „Marktfehlern“ kommen, die man ausnutzt, wenn man bei Wettanbietern auf Sportereignisse wettet.
Die Formel für Value
Die mathematische Grundlage des Value-Konzepts ist die sogenannte Expected-Value (EV)-Formel:
Wenn dieser Wert größer als 0 ist, handelt es sich um eine erfolgversprechende oder gewinnträchtige Wette – also eine mit „Value“. Man sollte langfristig einen Gewinn erwirtschaften, wenn man wiederholt solche Wetten abschließt. Dabei gibt dieser EV aus der Formel zugleich die prozentuale Größe des zu erwartenden Gewinns an.
Ein einfaches Beispiel: Wenn man eine Wette zu einer Quote von 2,10 angeboten bekommt, aber glaubt, dass die Chance für den Ausgang 50% (wie es bei einem Münzwurf der Fall wäre) beträgt, dann gilt nach Einsetzen in die Formel:
Das bedeutet: Man macht im Durchschnitt 5 % Gewinn pro Einsatz, wenn man solche Wetten wiederholt abschließt. Das ist offensichtlich die graue Theorie. Denn: Man wird wohl kaum jemanden finden, der einem eine 2,10 auf einen Münzwurf (wir nehmen Kopf, oder?) anbietet.
Denkbar wäre aber so ein Fall: Der FC Bayern München trifft auf Real Madrid im Viertelfinale der Champions League. Die Anbieter sehen Real Madrid vorne. Man bekommt nur eine 1,7 auf das Weiterkommen von Real. Bayern, als so gesehener Außenseiter, zahlt eine 2,10. Nicht unrealistisch.
Nun glaubt man, dass die Chance auf Bayern günstiger ist. Sie sind in Topform, Real hat zwar die Tradition und mehr Titel, aber derzeit überzeugen sie nicht ganz. Man glaubt an 50%. Es gibt keine Beweisführung, dass man sich verrechnet hat. Sie kommen weiter oder nicht. Ob man Value hatte? Das Ergebnis allein wird es nicht offenbaren. Zumal ihnen ein klarer Elfer verweigert wurde, oder?
Hier war nun von „glauben“ die Rede. Man glaubt an das Weiterkommen oder man glaubt an 50%. Es kann aber vorkommen, dass man eine unwahrscheinliche Chance tippt, auf die man eine gute Quote bekommt, aber bei der man selbst nicht an das Eintreten glaubt. Das wäre eher das, was umgangssprachlich das Value-Betting ausmacht (für die, die meinen, es verstanden zu haben). „Du wettest ja gar nicht auf das, an was du glaubst. Du wettest ja nur auf Value.“ Quasi gedanklich noch hinterhergeschickt: „Das ist ja doof. Das würde ich nicht machen.“
Solltest du aber…
Um dies am Beispiel zu erläutern: Würfel mit Value
Angenommen, man bietet dir eine Quote von 6,50 an auf eine bestimmte Zahl beim Würfeln – sagen wir: auf die 4. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem fairen Würfel diese 4 fällt, beträgt 1/6 ≈ 16,67 %. Die faire Quote wäre also 6,00 (1 / 0,1667).
Nun bekämst du aber 6,50 – und das ist mehr als die faire Quote. Damit liegt Value vor, den man auch über diese Formel berechnen kann:
Ein positiver Erwartungswert von 8,3 % – also eine lohnende Wette. Auch wenn man nicht „dran glaubt“, sollte man diese Wette annehmen. Warum?
Stellen wir uns vor, man setzt 1 Euro auf jede Runde, 600 Mal insgesamt. Statistisch wird man etwa 100 Mal richtig liegen (600 × 1/6). Der Gewinn pro Treffer liegt bei 5,50 Euro (6,50 Auszahlung – 1 Euro Einsatz). Also:
500 Mal verliert man je 1 Euro = 500 Euro Verlust
Ergebnis: +50 Euro nach 600 Runden, bei 600 Euro Einsatz. Eine durchschnittliche Rendite von 8,3 %, exakt wie berechnet.
Sportwetten: Wahrscheinlichkeiten sind nicht bekannt
Im Sport kennt niemand die Wahrscheinlichkeiten exakt. Nicht du, nicht ich, nicht einmal die Buchmacher. Die gute Nachricht: Das ist für alle gleich. Es gibt keinen Algorithmus, der exakte Wahrscheinlichkeiten ausspuckt. Es gibt nur Modelle, die versuchen, das möglichst gut abzubilden. Und es gibt den Wettmarkt, der die Quoten durch die eingehenden Einsätze reguliert. Dieser Markt bildet allerdings nicht die Wahrscheinlichkeiten ab, sondern eher das Wettverhalten der Masse.
Somit ist jede Quote, die sich bis zum Anpfiff entwickelt, das Produkt einer gewissen Massenintelligenz (auch „Schwarmintelligenz“ genannt). Und wie jede Masse liegt sie oft nicht ganz daneben, aber auch nicht garantiert richtig. Was sich daraus ergibt: Der Markt ist nicht unfehlbar – und das eröffnet Chancen. Wenn du ein besseres Modell hast oder den Markt in bestimmten Situationen besser verstehst, kannst du Abweichungen nutzen – also Value entdecken.
Zusammengefasst: Die gute Nachricht ist, dass die Wahrscheinlichkeiten niemand kennt. Die schlechte: Man selbst kennt sie wohl auch nicht, kann sich aber gut annähern. Eine unglaubwürdige (da nicht direkt beweisbare) Aussage des Autors hier: In 20 Jahren vollständig dokumentierter Wetten ergab sich ein Gewinn von über 3% des Umsatzes. Zugeben sollte man dabei aber auch: Es sind Jahre aus der Anfangszeit darunter, in denen der Markt noch nicht so effizient war.
Value erkennen – nicht erraten
Value-Betting bedeutet nicht, „Ich glaube, Team A gewinnt“ oder „Ich habe ein gutes Gefühl“, sondern: „Ich habe eine fundierte Einschätzung, die vom Markt abweicht, und diese Einschätzung ist besser.“
Wie kann man das erkennen? Indem man eigene Wahrscheinlichkeiten berechnet. Hierzu gibt es möglicherweise gängige Modelle oder auch Angebote im Netz, die Versprechungen machen. Zu diesen möchte man sich (an dieser Stelle) nicht näher äußern (inwieweit die Versprechungen gehalten werden können). Aber es gibt eine Software des Autors, die man bei betty findet und die in der Basisversion kostenlos ist.
Wichtig ist, dass man eine Basiszahl hat, eine gute Wahrscheinlichkeitseinschätzung, die möglichst nahe herankommt. Diese kann man nun anpassen, aufgrund von Formkurven, Spielverläufen, Verletztenlisten, Aufstellungen, Spielweise, Motivation, Bedeutung des Spiels – kurz: aus allem, was den Ausgang beeinflussen kann.
Am aktuellen Beispiel erläutert (vor dem Spiel!)
Wenn man z. B. die Siegwahrscheinlichkeit für den Sieg Spaniens auf 45% schätzt (Verlängerung zählt also nicht mit; nur die Siegwahrscheinlichkeit nach 90 Minuten; so etwa schätzt die Software betty das), hätte man die verbleibenden 55% (100% – 45%) auf das Ereignis „Spanien gewinnt nicht“.
Die faire Quote wäre somit 1 / 0,55 = 1,82. Der Markt zahlt eine Quote von 2,04 auf „England verliert nicht“ (also Sieg England oder Unentschieden), dann hat man Value, den zwischen 1,82 (eigene faire Quote) und 2,04 (Marktquote). Konkret kann man den (noch immer imaginären) Vorteil so berechnen:
Ein paar mehr Überlegungen zum EM-Finale 2025 – Spanien vs. England
Zwei große Namen, zwei starke Teams: Spanien gegen England. Und ein genauer Blick auf die Leistungen und Marktreaktionen zeigt: Hier gibt es möglicherweise Value.
Analyse des Turnierverlaufs:
England:
-
Startniederlage gegen Frankreich (1:2), aber mit guter Anfangsphase und einem zu Unrecht aberkannten Tor
-
Klare Siege gegen Niederlande und Wales
-
Beeindruckendes Comeback gegen Schweden (2:0-Rückstand aufgeholt, Spiel gewonnen, statistisch überlegen)
-
Halbfinale gegen Italien: zweite Halbzeit klar dominiert, über ein Tor Vorteil laut Should Goals (dies ist eine von unserer Software betty den xGoals gegenübergestellte Zahl, die sich mehr auf die Spielstatistiken stützt als die xGoals, die es allein auf die konkreten Torchancen tun)
Spanien:
-
Als Favorit ins Turnier gestartet
-
Sehr gute Vorrunde, überzeugend gegen Portugal, Belgien und Italien
-
K.-o.-Phase: Mühe gegen Schweiz (2:0 – aber beide Tore spät), gegen Deutschland erst 1:0 in der Verlängerung
-
Tordifferenz über das Turnier: 16😊
England: 14:6 – also schon klare Vorteile für Spanien, aber auch nicht gigantisch
Die Marktmeinung:
Der Markt sieht Spanien als Favorit. Die Quoten zeigen das klar: Auf „Spanien gewinnt in 90 Minuten“ gibt es nur ca. 1,77
(Tatsächlich ist die Quote aktuell bei bet-at-home bei 1,80 auf Spanien Sieg nach 90 Minuten.. Auf das Ereignis „England verliert nicht“ (also doppelte Chance 1X) liegt der Markt bei etwa 2,04.
Die Wettsoftware betty berechnet dagegen eine faire Quote von 1,82 – basierend auf den aktuellen Settings, die aber auf konkreten Ergebnissen über die letzten Jahre aufgebaut sind. Zudem ist England Titelverteidiger. Also irgendwas müssen sie schon können.
Was bedeutet das?
Der Markt neigt sich etwas zu sehr zu Spanien. England wird ein wenig unterschätzt. Hier werden die Ergebnisse (zum Beispiel Niederlage gegen Frankreich und Mühe gegen Schweden, beinahe ausgeschieden) gegenüber den Leistungen zu stark bewertet. Und Spanien hat die Menschen (vor allem aufgrund der Vorrunde mit den Siegen 5-0, 6-2, 3-1) etwas zu sehr beeindruckt. Es gibt also diesen Gedankenansatz, der die eigenen Zahlen stützt.
Es kommt ein Phänomen hinzu, das sich über die vielen großen Turniere beobachten lässt, aber eher ein intuitives, was dennoch Sinn ergibt.
Folgendes: Bei großen Turnieren schauen viel mehr Menschen zu. Diese Menschen bilden sich ebenfalls eine Meinung, wetten sonst aber nicht. Nur zum Turnier tut man es mal. Diese Neueinsteiger gehen eher der Intuition nach und setzen auf das, woran sie glauben, und zwar mehr als es die alten Hasen tun. So gibt es noch mehr Umsatz auf den Favoritensieg als sonst. Das drückt dessen Quote – der Außenseiter steigt.
Quasi vollständig hergeleitet, wie es zu einem solchen Tipp kommen kann: Hier immerhin eine beweisbare Aussage, denn schon im Halbfinale wollte betty unbedingt im Spiel gegen Spanien auf „Deutschland verliert nicht in 90 Minuten“ setzen. Und zugleich auf wenige Tore. Mit beiden Tipps lag sie richtig. Das findet man im Netz, da es vorab veröffentlicht wurde.
Wichtig: Ein Spiel ist keine Statistik
Selbst wenn England am Ende doch verliert – war der Tipp dann schlecht?
Nein.
Ein Value-Tipp kann verlieren, und ein schlechter Tipp kann gewinnen. Das liegt in der Natur der Sache. Beim Würfelbeispiel oben wird man auch 5 von 6 Mal verlieren – obwohl man eine profitable Wette gemacht hat.
Erst über viele, viele Wetten hinweg zeigt sich, ob du tatsächlich einen Vorteil hattest. Genau das ist der Kern des Value-Bettings: Langfristigkeit.
Fazit: Value-Betting ist kein Bauchgefühl – sondern Mathematik
Value-Betting ist kein Glücksspiel, sondern eine systematische Suche nach Fehleinschätzungen. Du brauchst:
→ ein Modell oder eine fundierte Einschätzung der Wahrscheinlichkeiten,
→ ein Vergleich mit den Marktquoten
→ und Geduld, um viele solcher Wetten durchzuführen.
Manchmal liegt der Value bei klaren Außenseitern. Manchmal bei unterschätzten Favoriten. Manchmal in Spezialmärkten wie Über/Unter oder asiatisches Handicap. Entscheidend ist immer: Quote > 1 / Wahrscheinlichkeit.
Dann schlägt der Erwartungswert positiv aus – und man schlägt langfristig den Markt.